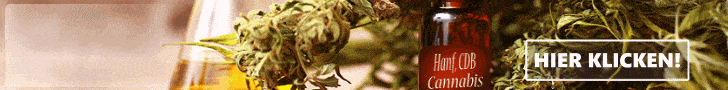Metaller.de – Wandern, Hanf und Heavy Metal
Auf Metaller.de findest Du Informationen und News zu Cannabis, Hanf und CBD sowie zur Cannabislegalisierung bzw. Entkriminalisierung, Wandern im Frankenwald und natürlich Heavy Metal. Rettet die Wälder … Hanf auf die Felder!
„Ich weiß nicht ob Hanf die Welt retten wird, aber es ist die einzige Pflanze die es kann!“ – Jack Herer
„Wissenschaft war Mangelware, aber sie wird für das nächste Kapitel der Cannabis-Industrie sehr wichtig sein.“ – Pflanzenpathologe Michael Ravendale
Mein „Cannabis-Studium“, Domainsammlung, das Cannabis-Gesetz, Hanfinfos und der Frankenwald

Cannabis boomt, auch in Deutschland. Der Boom von Hanf ist unbestritten. CBD (Cannabidiol) bzw. Cannabis oder Hanf ist ein riesiger Zukunftsmarkt! Unter Cannabis-Domains.de stehen über 3.000 zu den Themen Cannabis, Hanf, Growing und CBD zum Verkauf.
Informationen zum Verkauf sind unter http://www.cannabis-domains.de zu finden.
Hier wird über ELITEDOMAINS (hier direkt zur Domainliste) der Domainkauf treuhänderisch abgewickelt.
*** Werbung ***

Dein Cannabissamen für die Sorte Tisza - CSU
Dein Cannabissamen für die Sorte A.M.S.
Dein Cannabissamen für die Sorte Bangi Haze
Dein Cannabissamen für die Sorte Monster Dwarf Autoflowering
Dein Cannabissamen für die Sorte Grapefruit Diesel
Die Informationen auf Metaller.de sollen hauptsächlich informieren und sind nicht als Ersatz für professionelle rechtliche Beratung gedacht. Wenn du Fragen bezüglich der Legalität des Anbaus oder der Nutzung von Cannabis hast, empfehle ich dir, dich an einen qualifizierten Rechtsanwalt oder an eine offizielle Beratungsstelle zu wenden.
*** Anzeige ***

SPLIFFERS.de – Infos Social Clubs mit dem gewissen Etwas!
Tauche ein in die unvergleichbare Atmosphäre der Spliffers Social Clubs. Hier erwartet dich eine Kombination aus Entspannung, Ästhetik und Qualität. Ein unvergleichbares Erlebnis für Cannabisenthusiasten.

420cloud.io – Die perfekte Software zur Verwaltung deines Cannabis Clubs
Die Club Cloud ist die Lösung für die einfache und effektive Verwaltung eures Cannabis Clubs – 100% datenschutzkonform, rechtssicher und immer angepasst an die aktuelle Gesetzeslage!
Growhub.de – Professionelle Growanlagen für deinen Social Club Erfolg
Hochwertige Cannabis-Kultivierungsanlagen, die ideal für diejenigen sind, die einen Cannabis Social Club gründen möchten oder bereits einen Cannabis Social Club gegründet haben. Let’s grow together!
Cannabis Social Club in 16727 VeltenCannabis Social Club in 93449 Waldmünchen
Cannabis Social Club in 2894 Reichenbach
Cannabis Social Club in 23879 Mölln
Cannabis Social Club in 55218 Ingelheim am Rhein
Zu Beginn komme gleich zum aktuellen Stand: Ich werde mich in 2024 auf mein „Cannabis-/ Hanfstudium“ konzentrieren. Zum Ausgleich werde ich weitere Rundwanderwege beschreiten und Informationen dazu veröffentlichen.
Zudem wurde zum Thema Cannabislegalisierung von meiner Seite her auf Metaller.de eigentlich alles gesagt. Natürlich werde ich auf Metaller.de weiterhin Informationen zu Cannabis sammeln und Hanfprodukte testen, damit kochen und grillen und diesbezüglich Artikel, sowie Cannabis-Hanf-CBD-News auf Metaller.de veröffentlichen.
Cannabiskurse der Cannabis Akademie Deutschland und der ACM
*** Anzeige ***


Verkauf Cannabis-, Hanf-, Grow- und CBD-Domains Portfolio
Ich ziehe nun aber auch die Stress-Notbremse und werde mich schrittweise aus dem Online-Business und auch größtenteils aus dem Internet (vor allem Social Media) zurückziehen und habe mich dazu entschlossen meine Domainsammlung (Cannabis-Hanf-CBD-Domain-Portfolio), welche ich die letzten acht Jahre aufgebaut habe, zu verkaufen. Ab sofort starte ich verschiedene Preisaktionen bei ELITEDOMAINS (hier klicken!)! Weitere Infos dazu findest Du hier: Cannabis-, Hanf- und CBD-Domains Sammlungsauflösung Domain Portfolio Verkauf
Beispiele:
hanfnetwork.de zu verkaufen!
cannabisabgabe-gesetz.de zu verkaufen!
cbdcbdcbd.de zu verkaufen!
hanfshop-konstanz.de zu verkaufen!
hanfduschgel.de zu verkaufen!
*** eigene Anzeige ***

Beispiele:
thegrowshop.de zu verkaufen!
cbdmundoel.de zu verkaufen!
cannabiskrankenpfleger.de zu verkaufen!
thc-schnelltests.de zu verkaufen!
cbd-cbn.de zu verkaufen!
Beispiele:
hanfnaturfaser.de zu verkaufen!
funktionsarzneimittel.de zu verkaufen!
sweet-pure.de zu verkaufen!
hanfshop-fürth.de zu verkaufen!
cannabisbeverages.de zu verkaufen!
In einer Entscheidung betont der BGH, dass der Handel mit Domain-Namen, der grundsätzlich zulässig und nach Art. 12, 14 GG verfassungsrechtlich geschützt ist, nicht automatisch rechtsmissbräuchlich ist, selbst wenn eine Verkaufsabsicht besteht.
HORCH! Auf der gesamten Seite von (Hanf-)Metaller.de gilt: Bei Stern (*) oder (Werbung) handelt es sich um Werbung bzw. Affiliatelinks. Beim Klick auf die Anzeige / Link wirst Du auf eine neue Webseite weitergeleitet! Wird eine Bestellung über diesen Link abgeschlossen, erhalten wir womöglich eine Provision. Der Preis für den Käufer ändert sich jedoch nicht! Weitere Informationen zu verschiedenen Affiliate-Programmen finden sich in der Datenschutzerklärung.

Obacht! Auf Metaller.de findest Du KEINE Heil- bzw. Gesundheitsversprechen, sondern nur Erfahrungswerte und Neuigkeiten zum Thema Hanf (bzw. CBD und Cannabis). Bitte beachte dazu den gesundheitlich – medizinischen Haftungsausschluss! Metaller.de distanziert sich vom missbräuchlichen Cannabiskonsum.
Meinungsfreiheit und Informationsfreiheit sind wesentliche Pfeiler unserer Gesellschaft, die es jedem Individuum ermöglichen, sich frei zu entfalten und seine Berufswahl ohne Einschränkungen zu treffen. Diese Rechte sind fundamentale Bestandteile der Grund-, Gleichheits-, Freiheits- und Menschenrechte, die die Basis für eine freie und demokratische Welt bilden.
Vor Kontaktaufnahme bitte Folgendes unbedingt beachten: hier lesen!
*** Anzeige ***

Frankenwaldhanf – die Hanf-Manufaktur im Frankenwald (Bericht)
Tief im Frankenwald befindet sich ein kleiner Bauernhof, wo schon seit vielen Generationen mit der Natur und in der Natur gearbeitet wird. Für eine lange Zeit war die Nutzpflanze Hanf in Vergessenheit geraten, obwohl sie seit Äonen ein Begleiter war. Nun kommt sie aber wieder mit ganz großen Schritten zurück: In Sachen Faserhanf experimentiert der kleine Bauernhof im Frankenwald schon seit 2015 mit dieser großartigen Energiepflanze, wobei ständig viele neue und tolle Dinge dazugelernt werden.
Hier wird jeder Arbeitsschritt von vielen lieben Menschen selbstgemacht – von der Aussaat bis hin zur Ernte und Verarbeitung. Frankenwald Hanf kann damit viel Gutes für die Welt tun und plant dies auch zu machen. Schließlich kann Hanf auf vielerlei Arten eingesetzt werden und das Leben der Menschen positiv beeinflussen und verändern, wie z. B. in der Medizin, als Rohstoff, Baustoff, Brennstoff, erneuerbarer Kunststoff, Öl, Faser, Synergie, Energie und noch vieles mehr.
Du kannst im Frankenwald Hanf-Shop das Vollspektrum CBD-Öl mit unterschiedlichem Anteil kaufen. Denke daran, dass alle Artikel selbstgemachte Produkte sind, in welche auch viel Menschenliebe investiert wurde. Es wird keine Chemie benutzt und die Hanfpflanze wächst in Umgebung mit anderen Pflanzen natürlich auf. Das hat auch seine Vorteile, von denen Menschen profitieren können, insbesondere aber die Konsumenten im Bereich der Medizin.
Hier geht es zum großen Artikel „Frankenwaldhanf – die Hanf-Manufaktur im Frankenwald“ …

In den Jahren 2023 und 2024 werden auf diesem persönlichen Blog überwiegend Artikel über den Frankenwald (u. a. Wandern) und Grillrezepte (auch vegetarische und mit Hanf) von der Feuerplatte, aus dem Smoker und Dutch Oven auf Metaller.de veröffentlicht. Ich werde außerdem auf diverse CBD- und Hanf- (Cannabis-) Produkte verschiedener Hersteller detaillierter eingehen und werde mich vor allem dem Thema „Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf“ und den schier unendlichen Verwendungsmöglichkeiten (Heilmittel, Kleidung, Baustoffe, Farben, Lacke, Speiseöle, Papier usw.) der Superpflanze Hanf intensiver widmen und werde auf (Hanf-)Metaller.de weiterhin möglichst viele Informationen zum Thema Hanf sammeln! (weitere Infos über mich und Metaller.de -> hier!). 2022 wurde noch der The Walking Dead Episodenguide komplettiert. Informationen und ein paar Berichte für Metaller und Heavy Metal Fans wird es aber weiterhin geben …
Rettet die Wälder … Hanf auf die Felder!
„Ich weiß nicht ob Hanf die Welt retten wird, aber es ist die einzige Pflanze die es kann!“
„Es gibt nur eine Pflanze, die als nachwachsender Rohstoff in der Lage ist, den grössten Teil an Papier, Textilien und Nahrungsmitteln, sowie des Energieverbrauchs zu liefern und die zugleich die Umweltverschmutzung eindämmt, die Böden verbessert und unsere Luft reinigt: es ist eine alte Gefährtin, die dies schon immer getan hat: Cannabis, Hanf, Marihuana.“ (Jack Herer)
Die wichtigsten Artikel auf Metaller.de zum Thema Hanf (Cannabis) und CBD (Cannabidiol)
Es werden zahlreiche und wichtige Informationen aus der Welt von CBD, Hanf und Cannabis geboten. Erklärt wird viel Wissenswertes rund um die Superpflanze Hanf. Sehr interessant ist außerdem das Interview mit Uwe Gremer von Frankenwald Hanf! Da das Thema gerade sehr aktuell ist, gibt es News und Informationen zu den Vorteilen und der legalen Nutzung von CBD Produkten in Deutschland. Ich selbst konnte in den letzten Jahren (seit 2017) zum Thema CBD (Cannabidiol) und Hanf viel Erfahrung sammeln.
Growshop in 95173 Schönwald
Growshop in 8523 Plauen
Growshop in 4564 Böhlen
Growshop in 25764 Wesselburen
Growshop in 16775 Gransee
Aktuelle und wichtige Informationen zum Thema Cannabidiol (CBD Öl)

Mögliche Wechselwirkungen von CBD Öl mit Medikamenten
Wer CBD und gleichzeitig Arzneimittel einnehmen möchte, sollte immer vorsichtig sein. Besonders Menschen, die eine Chemotherapie durchmachen und das Blutverdünnungsmittel Warfarin einnehmen. Bei diesem Medikament besteht laut aktuellen Forschungen ein großes Risiko auf ernsthafte Schäden. Es ist ratsam mit seinem Arzt offen über die Einnahme von CBD zu sprechen. Wer Angst vor diesem Gesprächsthema hat kann seinen Arzt fragen, ob die Einnahme des Medikaments zusammen mit einer Grapefruit bedenklich ist. Denn beide natürlichen Mittel haben eine identische Wirkungsweise auf Medikamente … hier mehr zu Wechselwirkungen von CBD lesen …

Die mögliche Dosierung von CBD Öl (Cannabidiol)
Weist ein CBD Produkt eine besonders hohe Konzentration auf, muss das nicht zwangsläufig bedeuten, dass es ein gutes Öl ist. Im Gegenteil, die hohen Prozente werden durch immer weitere Extraktionsverfahren und im Endeffekt Manipulationen an der Reinheit der Pflanze vorgenommen. Ganz ähnlich verhält es sich übrigens mit den Reinstprodukten wie den CBD Kristallen. Weitere wertvolle Nebenstoffe gehen mit dem Grad der Filterung und Verarbeitung zunehmend verloren. Dazu gehören sekundäre Pflanzenstoffe, weitere Cannabinoide sowie Terpene und ätherische Öle. Außerdem ist darauf zu achten, ob besonders hohe Prozente gemeinsam mit anderen Trägerölen angeboten werden … hier mehr zur Dosierung von CBD Öl lesen …
Hanf und Hanfprodukte wie Hanföl
Hanf und Hanfprodukte wie Hanföl oder CBD-Öl werden von den meisten Menschen intuitiv mit Drogen in Verbindung gebracht. Marihuana, Haschisch und Kief werden zwar ebenso aus der Hanfpflanze hergestellt, unterscheiden sich aber grundsätzlich von legalen Produkten. Die berauschende Wirkung von Marihuana und Co. beruht auf THC. THC ist ein psychoaktives Cannabinoid, das unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) fällt. Grundsätzlich gilt für Hanföl und CBD Öl, dass sie nicht unter das BtMG fallen, solange sie einen THC-Gehalt von 0,2 (bald 0,3) Prozent nicht überschreiten.
Hanföl und CBD-Öl unterscheiden sich vor allem in ihrer Zusammensetzung. Bei Hanföl handelt es sich in der Regel um ein Vollspektrumöl. Das heißt, es enthält einen Großteil der Cannabinoide und Terpene der Hanfpflanze. Für Hanföl spricht, dass Terpene und Cannabinoid synergistische Effekte zeigen – sich also gegenseitig unterstützen. CBD-Öl enthält dagegen nur CBD. CBD gilt als das Cannabinoid mit der größten Bandbreite an medizinischen Einsatzmöglichkeiten.
Die Gemeinsamkeit beider Produkte ist die ölige Form. Dadurch soll die Bioverfügbarkeit erhöht werden. Cannabinoide sind fettlöslich. Durch das Öl können sie besser über die Schleimhäute des Dünndarms resorbiert werden.

Heavy Metal Merch Shop in Neustadt in Holstein
Heavy Metal Merch Shop in Rhens
Heavy Metal Merch Shop in Mainbernheim
Heavy Metal Merch Shop in Waldheim
Heavy Metal Merch Shop in Salzgitter
Was genau ist CBD Öl oder Cannabisöl?
CBD-Öl bzw. Cannabis-Öl erobern seit einigen Jahren den Markt. Sie gelten als vergessene Wundermittel, die ein großes medizinisches Potenzial haben. Bestätigt wird das durch wissenschaftliche Studien. Was CBD-Öl und Hanföl so wertvoll macht, erfahren Sie auf dieser Seite. Hinter dem Kürzel CBD verbirgt sich Cannabidiol, einer der zahlreichen in den CBD Blüten der Hanfpflanze enthaltenen Wirkstoffe. Wer nun aber an psychoaktive Wirkung oder gar direkt an Marihuana denkt, der irrt: Hanf kann weitaus mehr als berauschen.
Im Gegensatz zu anderen in der Hanfpflanze enthaltenen Wirkstoffen löst Cannabidiol keinen Rausch aus. Stattdessen löst es Krämpfe, beruhigt, wirkt schlaffördernd und sogar appetitzügelnd. Die beliebteste Darreichungsform für diesen milden Cannabis-Wirkstoff ist das sogenannte CBD-Öl.
Dass CBD-Öl mit Marihuana wenig zu tun hat, wird bereits beim Blick auf die verwendeten Hanfsorten deutlich. Für die Herstellung von CBD-Öl wird sogenannter Industriehanf verwendet.
Die unter diesem Begriff versammelten Sorten eignen sich u.a. gut für die Herstellung von Kleidung, nicht aber als Genussmittel: Sie zeichnen sich nämlich dadurch aus, dass sie kaum psychoaktive Wirkstoffe enthalten.
Besonders beliebt für die Produktion von CBD-Öl ist dabei die Sorte „Cannabis Sativa“, da sie besonders reich an Cannabidiol ist.

Alleskönner CBD Öl – das entspannende Cannabis-Öl
CBD-Öl ist für die innere Anwendung gedacht und kann in Dosen von wenigen Tropfen direkt aus der Flasche eingenommen werden. Damit das Öl seine volle Wirkung entfalten kann, wird außerdem oft empfohlen, vor und nach der Einnahme 15 Minuten lang nichts zu essen oder zu trinken. Der herbe Geschmacks von CBD-Öl ist dabei allerdings nicht jedermanns Sache. Daher ist das Öl nicht nur pur erhältlich: Von der Einnahme von Kapseln bis hin zum Verdampfen mit der E-Zigarette sind ganz unterschiedliche Darreichungsformen möglich.
Um den Eigengeschmack des Öls ein wenig abzumildern, kann es aber auch ganz einfach in Salate, Suppen oder auch in süßes und salziges Gebäck gemischt werden. Hier findest du ein FAQ zum Thema CBD …
*** Anzeige ***

Warum ist die Behandlung mit CBD Öl vollkommen legal?
Auch wenn Cannabis in anderen Ländern der Erde immer häufiger ärztlich verordnet wird, ist der Konsum von Cannabis in Deutschland noch immer illegal. Ob als Genussmittel oder als Medikament: Wer Cannabis zu sich nimmt, macht sich strafbar. Zwar besteht grundsätzlich die Möglichkeit, einen Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für die Behandlung medizinischem Cannabis zu stellen, doch werden diese nur in den seltensten Fällen genehmigt. Hinzu kommt, dass deutsche Krankenkassen medizinisches Cannabis bislang nicht in ihre Leistungskataloge aufgenommen haben.
Wird eine Ausnahmegenehmigung erteilt, fallen daher schnell hohe Kosten für die Eigenbeteiligung des Patienten an. Und hat der Konsum von Cannabis Auswirkungen auf die Potenz?
Da es nicht psychoaktiv wirkt, stellt CBD-Öl bzw. Cannabis-Öl eine legale Alternative für die Behandlung mit Cannabis-Wirkstoffen dar. Aufgrund des speziellen Produktionsverfahrens enthält es – wenn überhaupt – nur noch Kleinstmengen von THC. Dieser Wirkstoff its vorrangig für die psychoaktiven Eigenschaften von Cannabis verantwortlich. In CBD Öl ist er bereits aufgrund der verwendeten Hanfsorte so gering dosiert, dass das Öl kein High mehr auslösen kann. Gewöhnlich ist der TBC-Anteil bei der Einnahme gar nicht mehr zu spüren.
Aus diesem Grund ist CBD-Öl auch in Deutschland ein vollkommen legales Hanfprodukt. Zahlreiche Apotheken führen CBD-haltige Präparate und sowohl im Internet als auch in manchen Drogeriemärkten sind diese und auch das Öl selbst leicht inzwischen leicht erhältlich.

Hanf – von starken Seilen zum Millionenmarkt
Die Menschen verwenden die Hanfpflanze schon seit mehr als 5.000 Jahren. Die Chinesen nutzten die widerstandsfähigen Hanffasern, um Seile, Stoffe und Segeltüchern zu fertigen. Noch heute werden die Naturfasern genutzt, um Textilien oder naturfaserverstärkte Kunststoffe herzustellen.
Spätestens seit 2.400 v. Chr. gilt Hanf nicht nur als nützlicher Rohstoff, sondern auch als Medizin. Damals wurden die ersten Tees aus Hanf zubereitet und anschließend gezielt eingesetzt, um Beschwerden zu lindern. Ihr medizinisches Wissen über Heilpflanzen wie Hanf hielten die Chinesen in dem fast 5.000 Jahre alten Buch „Shennong Bencaojing“ fest. Von China aus trat Hanf seinen Siegeszug an und überzeugte die alten Ägypter, die Griechen und andere europäische Völker. Im 16. Jahrhundert gelangte Hanf durch die Kolonialisierung nach Amerika.
Therapeutisches Potenzial der Hanfpflanze
In den folgenden Jahrhunderten wurde immer mehr über das therapeutische Potenzial der Hanfpflanze entdeckt. Beispielsweise verschrieb der Leibarzt von Queen Victoria der britischen Monarchin Hanf gegen ihre Menstruationsbeschwerden. Doch einen deutlichen Sprung vorwärts machte die Wissenschaft erst in den letzten Jahrzehnten. Das Ergebnis: CBD-Öl und Hanföl eroberten den globalen Markt. Inzwischen gibt es Hanf-Fonds, in die Hedgefonds-Manager unglaubliche Summen zahlen, um vom Aufschwung der Branche zu profitieren.
Das Wachstum der Hanf-Branche wird vor allem durch die Wissenschaft befeuert. Es gibt anerkannten Medikamente auf der Basis von CBD, die gegen bestimmte Epilepsieformen eingesetzt werden. Weitere therapeutische Einsatzmöglichkeiten werden durch vielversprechende Studien ausgelotet. Doch was macht Hanf im Allgemeinen und CBD im Spezifischen so wertvoll?

Hanföl und CBD Öl – was ist das?
Für die medizinischen Wirkungen von Cannabis sind Pflanzenstoffe verantwortlich, die es in dieser Vielfalt nur in Hanf gibt: Cannabinoide. Cannabinoide werden von Pflanzen gebildet, um sich vor Fressfeinden zu schützen. Cannabis ist nicht die einzige Pflanze, die die Schutzstoffe bildet. Lebermoos, Sonnenhüte und Jambú synthetisieren ebenfalls Cannabinoide. Doch Hanf stellt Cannabinoide her, die in keinen anderen Pflanzen vorkommen. Insgesamt 113 einzigartige Cannabinoide wurden bisher in Cannabis entdeckt.
Cannabidiol, kurz: CBD, ist eines dieser Cannabinoide. Es ist seit circa zwei Jahrzehnten der Gegenstand intensiver Forschungsarbeit. Dabei entdecken Forscher immer wieder therapeutische Anwendungsmöglichkeiten. Häufig fehlt es jedoch an hochwertigen Humanstudien, um die Erkenntnisse zu bestätigen.

Wie funktionieren Cannabinoide?
CBD-Öl und Hanföl entfalten im Körper ihre Wirkung über dieselben Rezeptoren. Um den Überblick zu bewahren, wird jedoch nur die Wirkungsweise von CBD genauer beleuchtet.
Cannabinoide interagieren im Körper mit bestimmten Cannabinoid-Rezeptoren. Diese Rezeptoren werden CB1- und CB2-Rezeptoren genannt und bilden gemeinsam das Endocannabinoid-System. Das Endocannabinoid-System wurde in den 90er Jahren entdeckt und galt für die Wissenschaftler als der Beweis dafür, dass der Körper selbst Cannabinoide herstellt.
Wenige Jahre darauf wurde das inzwischen am besten erforschte Cannabinoid, Anandamid, entdeckt. Seither werden Cannabinoide in körpereigene Endocannabinoide und pflanzliche Phytocannabinoide unterschieden. Die Wirkungsweisen der beiden Formen unterscheiden sich kaum. Beide gehen eine Verbindung mit den Cannabinoid-Rezeptoren ein und lösen so spezifische Stoffwechselprozesse aus. Die Art der Prozesse hängt vor allem von der Art der Zelle und der Lage des Rezeptors ab. Da sich CB-Rezeptoren fast im gesamten Körper finden lassen, unterscheidet sich die Wirkung je nach Zelltyp. Daneben können die Rezeptoren sowohl an der Zellwand als auch an einzelnen Zellorganellen sein. Kurz: Die Wirkungsmechanismen sind komplex.
Der Unterschied zwischen CBD und anderen Cannabinoiden
CBD unterscheidet sich in der Wirkung von anderen Cannabinoiden. Cannabinoide wie THC und Anandamid aktivieren die CB-Rezeptoren. Sie wirken agonistisch. CBD wirkt jedoch antagonistisch und hemmt die Wirkung. CBD kann man sich wie einen falschen Schlüssel in einem Schloss vorstellen. In das Schloss kann kein anderer Schlüssel gesteckt werden, wodurch die Tür ungeöffnet bleibt. CBD blockiert die Rezeptoren, sodass andere Cannabinoide den Rezeptor nicht mehr aktivieren können.
Zur Behandlung welcher Krankheitsbilder wird CBD-Öl eingesetzt?
Die Erforschung von CBD steckt noch in den Kinderschuhen. Es gibt zwar eine Vielzahl von Studien mit Tieren sowie in-vitro-Versuche (Reagenzglasversuche), aber deren Aussagekraft ist gering. Viele gesundheitsbezogene Aussagen beruhen daher auf den Erfahrungen von Konsumenten.
Zur medikamentösen Behandlung wird CBD lediglich in Amerika bei zwei schweren Epilepsieformen von Kindern verwendet, die ansonsten behandlungsresistent sind. Dabei handelt es sich um das Lennox-Gastaut- und das Dravet-Syndrom. Insbesondere Dravet-Kinder profitieren von dem CBD-Medikament. In Deutschland sprechen sich Experten zunehmend für die Zulassung des Medikaments aus.
Ansonsten gelten einige Erkenntnisse als gesichert, die jedoch noch nicht in der medizinischen Praxis angekommen sind. Als wissenschaftlich erwiesen gilt, dass:
- CBD angstlindernd wirkt: 2015 erschien eine Review der aktuellen Studienlage in der renommierten Fachzeitschrift „Neurotherapeutics“. In der Review kommen vier amerikanische Wissenschaftler zu dem Schluss, dass CBD bei generalisierter Angststörung, Panikstörung, sozialer Angststörung, zwanghafter Zwangsstörung und posttraumatischer Belastungsstörung helfen kann.
- CBD bei depressiven Symptomen hilft: Sowohl Tier- als auch Humanstudien weisen auf einen antidepressiven Effekt von CBD hin. Wissenschaftler vermuten, dass CBD die Funktionsweise von Serotonin-Rezeptoren verändert. Das sind Rezeptoren, an die das „Glückshormon“ Serotonin andocken kann.
- CBD chronischen Schmerzen entgegenwirkt: Insbesondere der Einsatz bei Arthritis gilt als vielversprechend.
- CBD Schlafbeschwerden lindert: Schon 1981 wurde eine vielversprechende Humanstudie mit fünfzehn Teilnehmern, die an Schlafstörungen litten, publiziert. Schlafdauer und -qualität verbesserten sich signifikant.
- CBD Stress mindert: CBD dämpft die Reaktion auf Stressoren und hemmt die Sekretion von Stresshormonen.

Schmerzen lindern mit CBD Öl
Aufgrund seiner entspannenden und beruhigenden Wirkung wird CBD-Öl vorrangig eingesetzt, um Schmerzen und die Symptome neurologischer Erkrankungen zu mildern. Patienten mit chronischen Schmerzerkrankungen wie Fibromyalgie und Arthritis wissen seine schmerzlindernde Wirkung zu schätzen, während Parkinson- und Migräne-Patienten das Lösen CBD Öl dazu einsetzen, Krämpfe und Verspannungen zu lösen. Patienten, die unter durch ADS oder ADHS bedingter innerer Unruhe oder auch unter Angststörungen und Burn Out leiden, schwören wiederum auf die entspannenden Eigenschaften von CBD. Sie erlaubt es ihnen, im Alltag leichter die Konzentration zu halten und sich gegen plötzliche Anspannung zu verteidigen. Und selbst in der Behandlung von Übergewicht kann CBD zum Einsatz kommen, da es den Appetit ein wenig dämpft.
Darüber hinaus kann CBD-Öl bzw. Hanföl aber auch eine bereits bestehende medikamentöse Behandlung gut ergänzen. Zahlreiche Medikamente zur Behandlung von neurologischen Erkrankungen – seien es Mittel gegen ADHS oder Antidepressiva – stimulieren den Organismus. Viele Patienten empfinden diese Wirkung jedoch als zu stark: Sie leiden im Alltag konstant unter einem starken Gefühl der Anspannung, unter Ruhelosigkeit und Nervosität. Die entspannende Wirkung des Cannabidiols kann diese Nebenwirkungen ausgleichen, ohne der Wirkung der Medikamente Abbruch zu tun. Dasselbe gilt auch für Medikamente, die als Nebenwirkung den Appetit der Patienten steigern: Ihnen kann ebenfalls CBD als Ausgleich entgegen gesetzt werden.
Das sollten Sie bei der Behandlung mit CBD Öl beachten
Bislang sind in Deutschland weder Cannabis noch seine Wirkstoffe offiziell als Arzneimittel anerkannt. Daher wird CBD-Öl entweder als Bestandteil in Kosmetik oder als Nahrungsergänzungsmittel verkauft. Die Behandlung mit CBD erfolgt daher stets auf eigene Verantwortung – kann aber mit Ärzten, die gegenüber alternativen, natürlichen Heilmitteln aufgeschlossenen sind, im Vorfeld abgesprochen werden. Zudem können Apotheker bei der Wahl des passenden Präparats und auch in Bezug auf die richtige Dosierung beratend zur Seite stehen. Dies ist besonders wichtig für die Behandlung von Kindern, da für sie zumeist eine besonders schonende Dosierung von Vorteil ist.
Sollten bei der Behandlung mit CBD-Öl überhaupt Nebenwirkungen / Wechselwirkungen auftreten, fallen diese gewöhnlich milde aus. Sie manifestieren sich bereits innerhalb der ersten zwei Wochen nach Beginn der Einnahme – und verschwinden in vielen Fällen auch wieder, sobald sich der Körper an das CBD gewöhnt hat.
*** eigene Anzeige ***

Infos zur Domain Sammlungsauflösung unter -> Domainsale und https://cannabis-domains.de !
Vor Kontaktaufnahme bitte Folgendes unbedingt beachten: hier lesen!
Die Kryptowährung Bitcoin (BTC)
Die Kryptowährung Audius (AUDIO)
Die Kryptowährung Frax Share (FXS)
Die Kryptowährung Cocos-BCX (COCOS)
Die Kryptowährung BarnBridge (BOND)
———-
Autor: Michael Färber